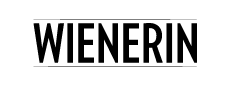© Shutterstock
Jahrelang ging Reinhard Reinisch vorbildlich zur Prostatakrebsvorsorge. Als ein PSA-Test anzeigt, dass er einen Tumor hat, ist es dennoch schon fast zu spät.
Reinhard Reinisch geht sehr offen mit seiner Krankheit um. Tatsächlich war er es, der sich mit seiner Geschichte an die STEIRERIN gewandt hat, da es ja oftmals gerade die Frauen sind, die ihre Partner dazu bewegen, zur Vorsorge zu gehen. Der 55-jährige Oberösterreicher, der seit fast 30 Jahren in Graz lebt, unterrichtet an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Werken und Bildnerische Erziehung und erzählt im Interview von seinen Erfahrungen.
Wie kam es zu Ihrer Diagnose?
Reinhard Reinisch: Mit Anfang 50 ging ich völlig symptomfrei zur Routineuntersuchung zum Urologen. Dass dieser Besuch letztlich zum schlimmsten Arztbesuch meines Lebens werden würde, konnte keiner ahnen. Nach dem Abklärungsgespräch fragte mich der Arzt, ob ich im Zuge der Untersuchung auch einen PSA-Wert (Prostataspezifisches Antigen) ermitteln lassen möchte. Ich kannte damals den Begriff nicht, aber da es sich um einen Bluttest handelt, hielt ich es für eine gute Idee. Eine PSA-Testermittlung war mir davor nie angeboten worden, nur Ultraschall und rektale Abtastung. Kurz nach dem Arztbesuch erhielt ich einen Anruf mit der dringenden Bitte, mich einer MRT-Untersuchung zu unterziehen: Mein PSA-Wert lag bei 16, der Normalwert wäre ca. 3. Es stellte sich dann heraus, dass ich einen Tumor in der Prostatakapsel hatte.
Prostatakrebsvorsorge ist essenziell

Bevor ich selbst betroffen war, habe ich mich mit meiner
Reinhard Reinisch
Prostata gar nicht beschäftigt.
In Ihrer Familie sind Sie leider nicht die erste Person mit Krebs?
Nein, meine Schwester starb mit 37 Jahren an Brustkrebs, meine Tante an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das spielt natürlich gefühlsmäßig eine große Rolle, wenn man selbst eine Diagnose bekommt.
Wie ging es dann weiter?
Es stellte sich nach der Biopsie leider heraus, dass ich eine äußerst aggressive Form von Prostatakrebs hatte, die zwar noch lokal begrenzt in der Prostatakapsel sei, sich aber schnell ausbreite. Ich musste wegen der Pandemie zwei bis drei Monate auf einen OP-Termin warten. In dieser Zeit hat sich der Tumor so dermaßen schnell ausgebreitet, dass die ganze Prostata entfernt werden musste. Nach der Operation sagte mir der Urologe, dass ich ohne den chirurgischen Eingriff wahrscheinlich nur mehr zwei Monate zu leben gehabt hätte.
Wie verlief die Operation?
Die Prostatektomie wurde minimal invasiv mit der sogenannten „DaVinci-Methode“ durchgeführt, die neben hoher Präzision eine schnellere Heilung verspricht. Trotz allem war ich für ca. 110 Tage in Behandlung und im Krankenstand. Das ist keine Blinddarm-OP, man wird mit Gas aufgebläht und mithilfe der Robotik-Methode operiert. Die Prostata und der Harnschließmuskel wurden entfernt. Ich bekam natürlich einen Katheter und vom Gas hatte ich Schmerzen bis in die Schultern, das war der Horror. Dann muss man wieder gehen lernen, was aber wichtig ist, damit man die Gase rausarbeitet.
Ich war im Anschluss auf Reha, bin nun wieder zurück in meinem Beruf, befinde mich aber noch immer in Rekonvaleszenz, da die Nachwirkungen bei einer Entfernung der Prostata auch bleibenden Schaden mit sich bringen.
Wie konnten Sie das psychisch verarbeiten?
Natürlich geht es mir nicht besonders gut. Mein ganzes Leben war von heute auf morgen dahin. Und es ist natürlich eine große Belastung, dass man nicht weiß, ob der Krebs wiederkommt. Aktuell ist meine große Sorge, dass auch die Lymphknoten befallen waren, meine Chance ist 50 : 50. Ich lebe momentan von PSA-Wert zu PSA-Wert.

Wie geht es Ihnen heute?
Ich hatte sechs fürs Immunsystem sehr belastende Untersuchungen, seit einem Jahr ist mein Immunsystem am Ende, ich bin ständig krank. Ich lebe seit der Diagnose vegetarisch bis vegan und verzichte weitgehend auf Zucker (Krebs liebt Zucker). Alle Medikamente zur Nachbehandlung müssen privat bezahlt werden, die Kassen übernehmen hierzu nichts – das sind im Schnitt ca. 150 bis 200 Euro im Monat. Es bleibt außerdem der Kampf gegen Inkontinenz, die ich aber über die Monate mit Beckenbodenübungen relativ gut in den Griff bekommen habe. Und nicht zuletzt das leidige Thema mit der Potenz. In meinem Fall konnte zwar das Nervenbündel um die Prostata, das sogenannte neurovaskuläre Bündel, das für eine Erektion von Wichtigkeit ist, größtenteils erhalten werden. Ohne Medikamente und deren Nebenwirkungen wird mir ein erfülltes Intimleben mit meiner Frau aber nicht mehr möglich sein.
Was heißt das genau?
Ich benutze SKAT-Injektionen (Schwellkörper-Autoinjektionstherapie), aber man bekommt davon keine natürliche Erektion, sondern eben eine herbeigeführte. Für mich ist das körperlich ganz etwas anderes. Ich bin auch nicht nur mein Penis, da gehört Gefühl dazu. Und wenn man sich eine Spritze setzen muss, ist das ein Stimmungskiller, die Spontanität fällt weg. Für meine Frau ist das natürlich auch ein großes Thema. Leben muss ich mit der Krankheit, aber sie leidet verständlicherweise mit. Aber man muss sagen, wenn man in einer stabilen und liebevollen Beziehung ist, hilft das schon ungemein.
Wie schwer fällt es Ihnen, über solche Tabuthemen zu sprechen?
Ich kann das nicht wegdiskutieren, gerade weil meine Frau ja auch deutlich jünger ist als ich. Daher möchte ich ein bisschen aufklären. Bevor ich selbst davon betroffen war, habe ich mich mit meiner Prostata gar nicht beschäftigt.
Ihre Botschaft an andere Männer?
Ich rate jedem Mann ab 40 bis 45 Jahren, jährlich zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen und unbedingt einen PSA-Wert ermitteln zu lassen. Das ist ein Bluttest, der kostet um die 30 Euro, tut nicht weh, ist nicht unangenehm und kann (wie bei mir) lebensrettend sein. Frauen sind da viel vernünftiger, sie gehen standardmäßig zur Gynäkologin. Das ist unangenehm, aber gehört halt irgendwie dazu. Daher finde ich, dass meine Geschichte in einer Frauenzeitschrift richtig angesiedelt ist, denn Frauen können leichter auf ihre Männer einwirken und sagen: „Bitte geh zur Vorsorge!“